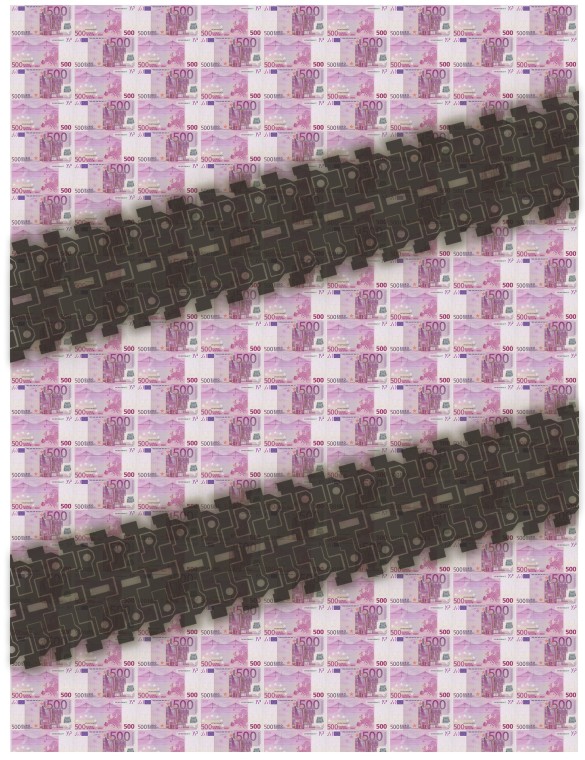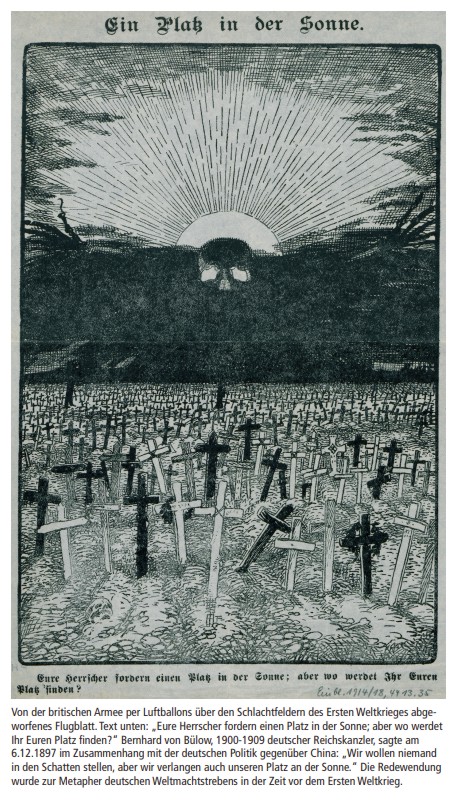Trauerrede von Sebastian Gerhardt
Liebe Annette,
liebe Mitglieder der Kuczynski-Großfamilie,
liebe Freunde und Weggefährten,
liebe Nachbarn von Thomas und Annette,
verehrte Trauergäste,
heute haben wir uns eingefunden, um gemeinsam Abschied zu nehmen, indem wir uns an Thomas erinnern. Jede und jeder hat viele Gründe, hier zu sein. Viele sind hier, die Thomas länger kennen als ich, und ihn ganz anders kennengelernt haben. Mein Name ist Sebastian Gerhardt. Dass ich allein hier vorn stehe und rede, heißt nicht, dass ich für alle sprechen könnte. Ich stehe hier, weil wenige Tage vor seinem Tod Thomas mich in einem Gespräch mit Annette danach gefragt hat. Und es gibt Fragen, auf die kann man nicht mit „Nein“ antworten.