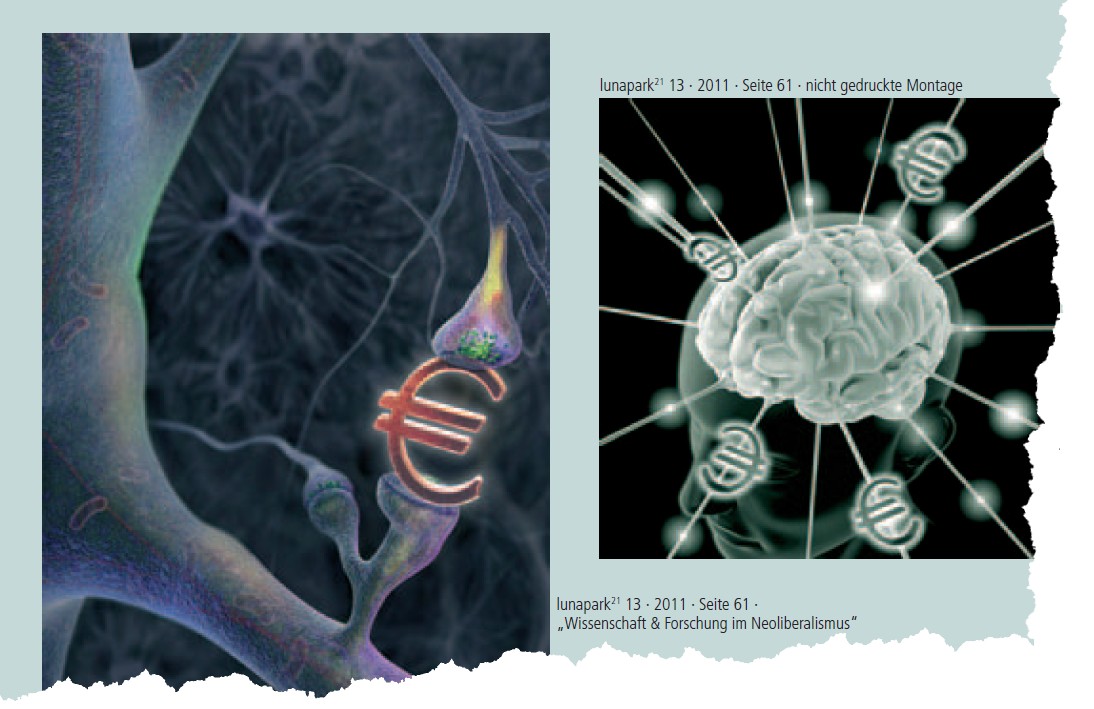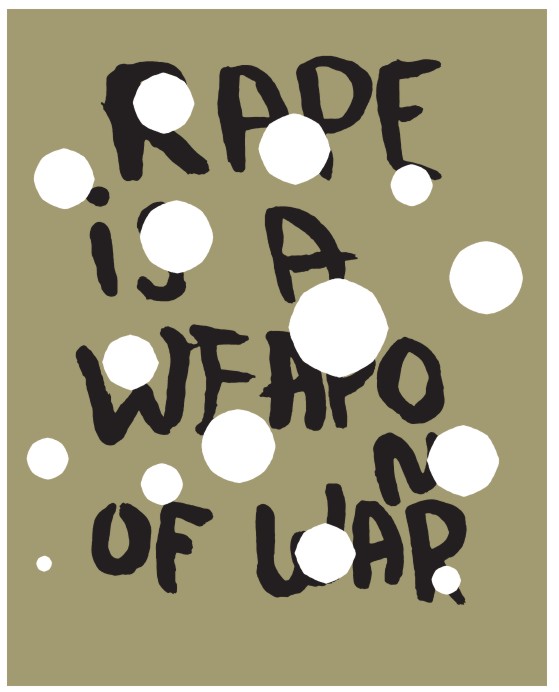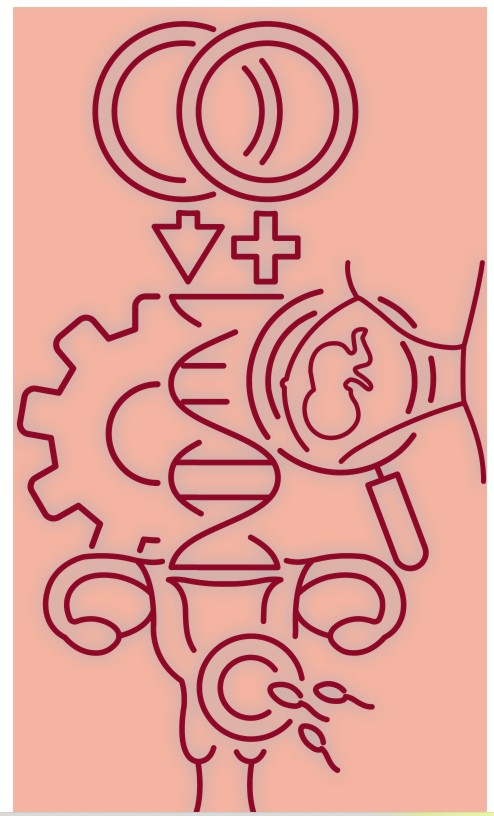Das Leihmutterschaft-Geschäft in der Ukraine
„Wir betrachten die Leihmutterschaft als eine medizinische Behandlungsmethode, nicht als eine käufliche Dienstleistung.“
Oksana Kashyntseva, ukrainische Juristin und Gastwissenschaftlerin an der Universität Zürich
Unter dem Krieg in der Ukraine leidet auch der Handel. Neugeborene, ausgetragen in Leihmutterschaft, können nicht ausgeliefert werden und sind bis auf weiteres in Bunkern untergebracht.
Die sogenannten Wunscheltern – womit nicht Eltern gemeint sind, die man sich wünschen würde, sondern ungewollt kinderlose Paare – sind in Sorge und wissen nicht, wann sie ihre bestellten Kinder werden abholen können. Das Auswärtige Amt fordert deutsche Staatsangehörige dringend auf, die Ukraine zu verlassen. Der Luftraum ist geschlossen.
Anbieter und Vermittler von Leihmutterschaften versuchen ihre Kund:innen mit Videos zu beruhigen, die eine sichere und komfortable Unterbringung von Neugeborenen und Leihmüttern in den Bunkern zeigen: Die Babys werden dort regelmäßig gefüttert, gewickelt und gebadet, jedes hat ein eigenes Bettchen, alles hygienisch und mit Handschuhen.
weiterlesenBunkerbabys – bestellt und nicht abgeholt