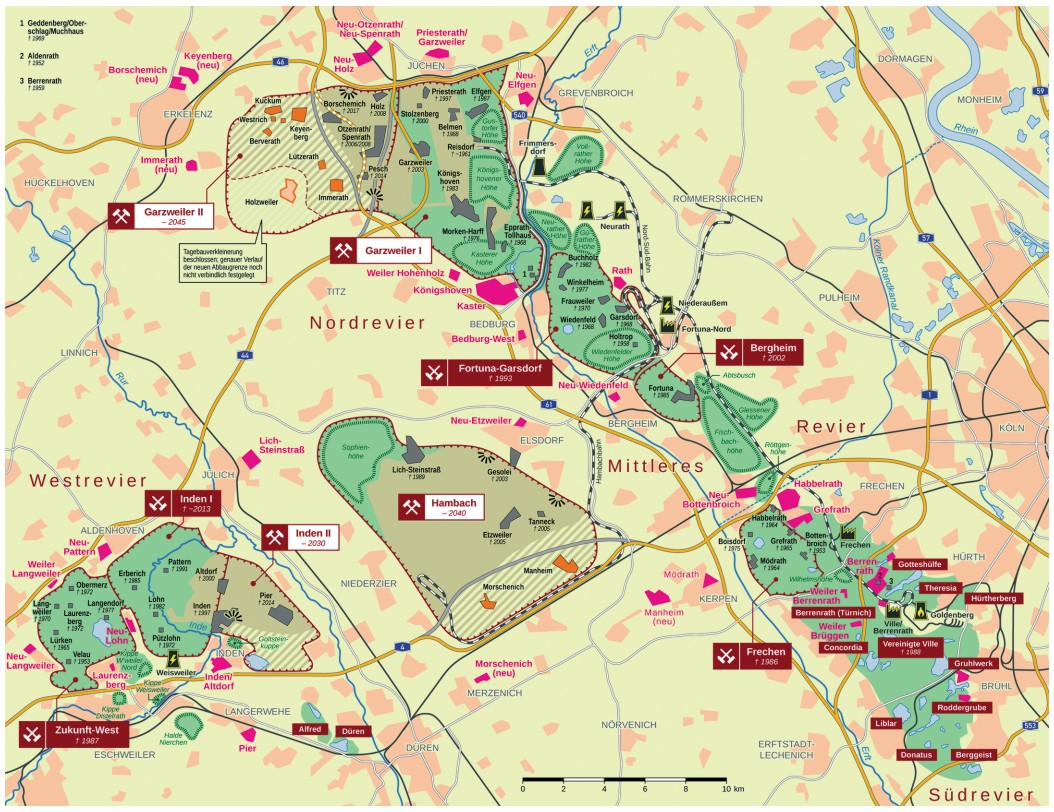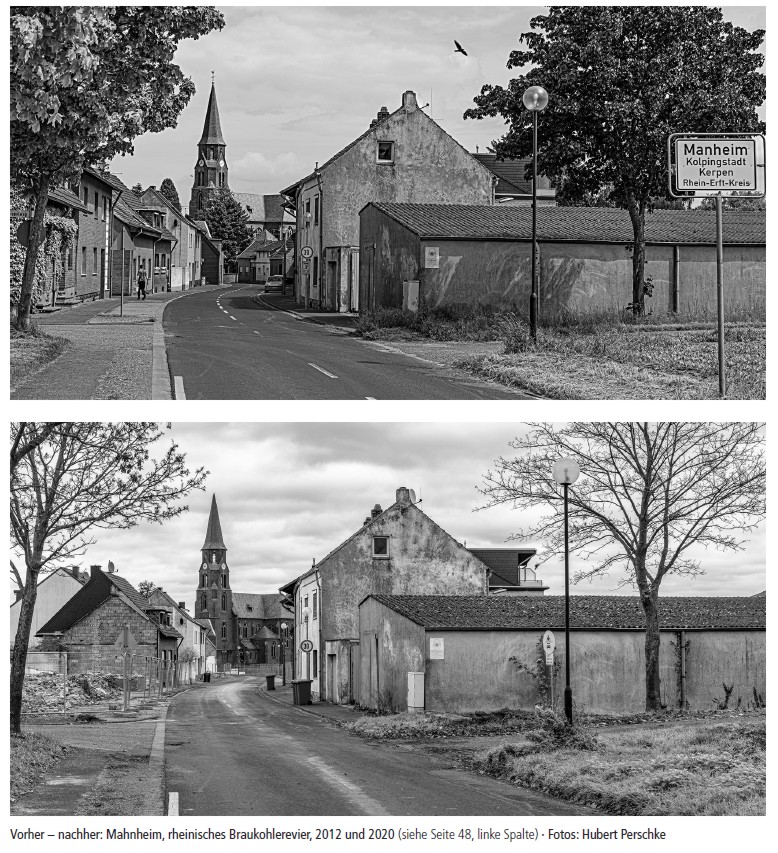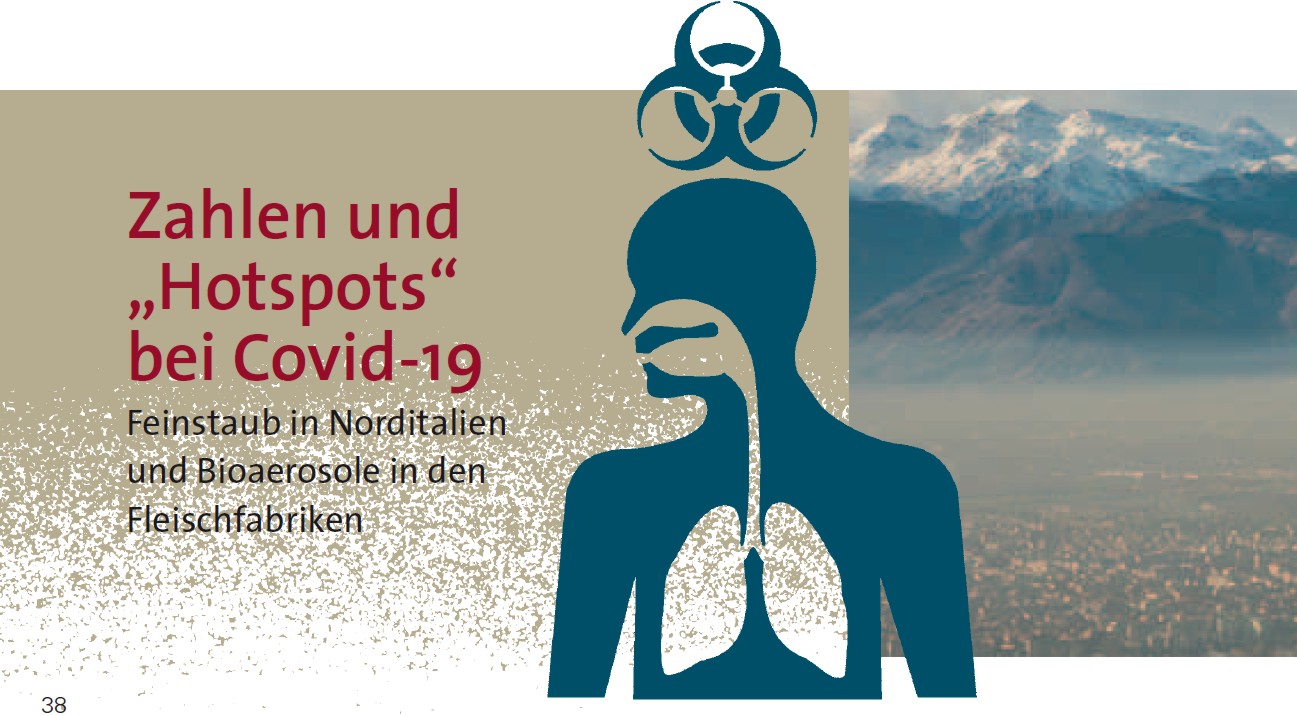Vom drohenden Überschreiten roter Linien
Greta Thunberg, Galionsfigur der Fridays-for-Future-Bewegung, hat es in ihrer erfrischenden Art auf den Punkt gebracht. Die diesjährige UN-Klimakonferenz hat aus der Sicht der Klimaschützer, der besonders bedrohten Inselnationen und indigenen Gemeinschaften mal wieder herzlich wenig gebracht. Nichts als „Bla, bla, bla“ eben, wie Thunberg es Mitte November auf Twitter zusammenfasste.
Das ist aus der Sicht der Klimaschutzbewegung sicherlich richtig. Der Fortschritt ist in den nun bereits seit über 30 Jahren geführten Verhandlungen noch immer eine Schnecke. Die Erde erwärmt sich zusehends. Inzwischen ist klar, dass sich der Meeresspiegelanstieg beschleunigt und der letzte Bericht des UN-Klimarates, des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), hat unter anderem festgestellt, dass ein Meeresspiegelanstieg um bis zu zehn Meter bis zum Ende des Jahrhunderts möglich, wenn auch äußerst unwahrscheinlich ist.
Aber um einen Meter wird das Meer wohl auf jeden Fall steigen. Und dies im globalen Mittel. In einigen Regionen kann es auch etwas mehr sein, da sich Rotation und Schwerkraftfeld der Erde durch das Abtauen der Eismassen verändern. Besonders in den Tropen, dort wo viele flache Inselstaaten liegen, wird das Meer überdurchschnittlich steigen.
Doch werfen wir einen Blick in die Abschlusserklärung, um die hart gerungen wurde. Mehr als 24 Stunden wurden die Verhandlungen überzogen, solange wie selten zuvor bei ähnlicher Gelegenheit. Und derlei Konferenzen gab es schon viele. Bereits zum 26. Mal waren die Vertragsparteien der Klimarahmenkonvention, 195 Staaten sowie die EU, zusammengekommen. Conference of Parties heißt das Spektakel, daher die Abkürzung COP26.
weiterlesenDie Bla-bla-Klima-Konferenz in Glasgow