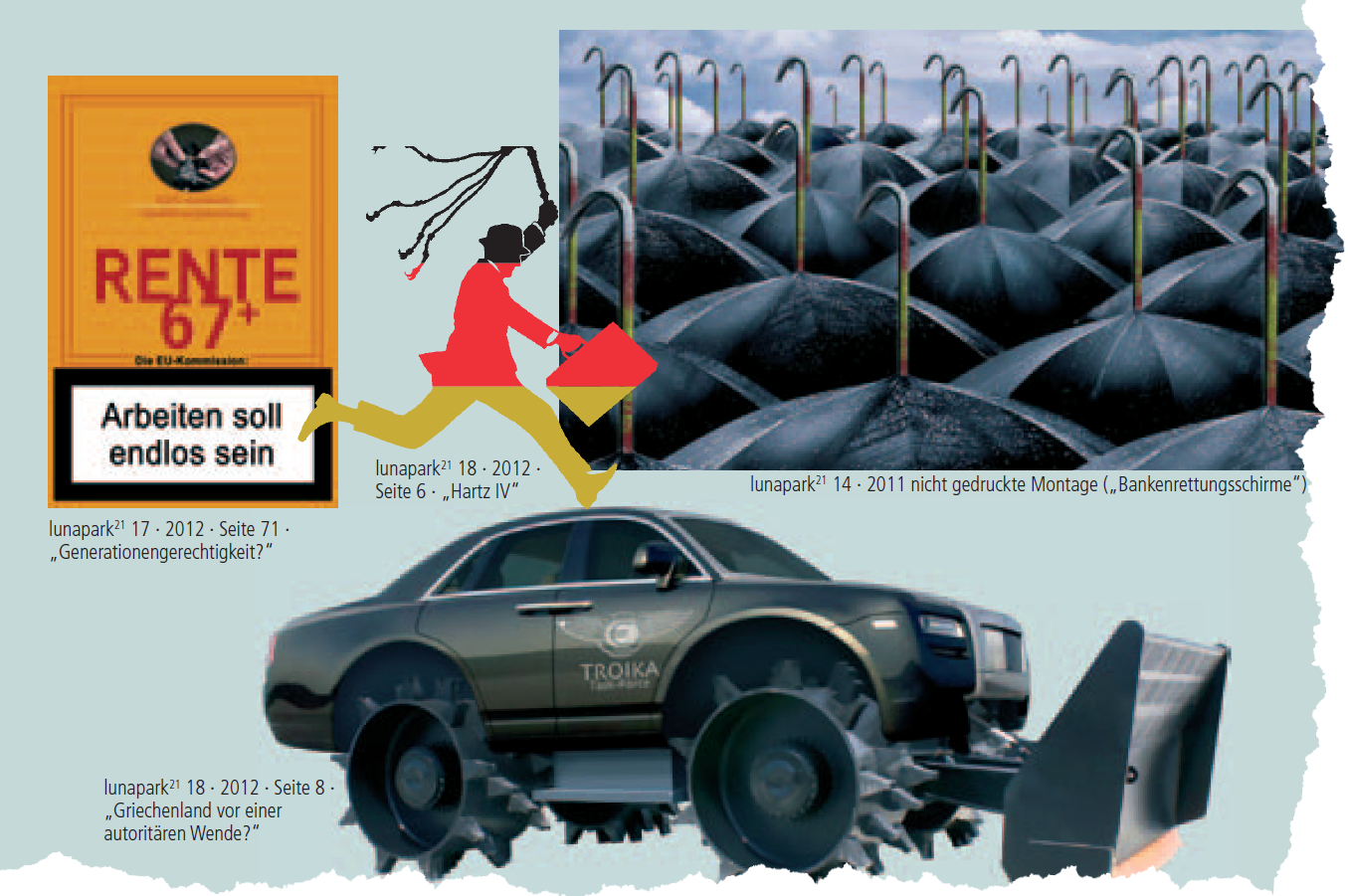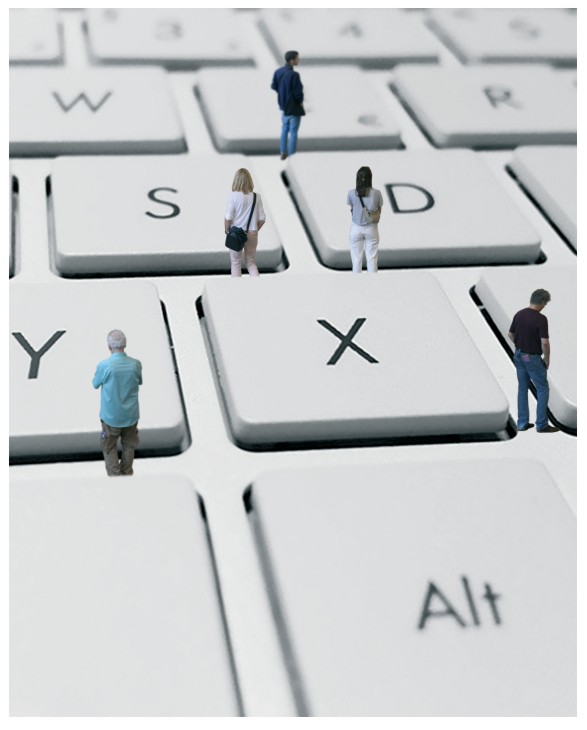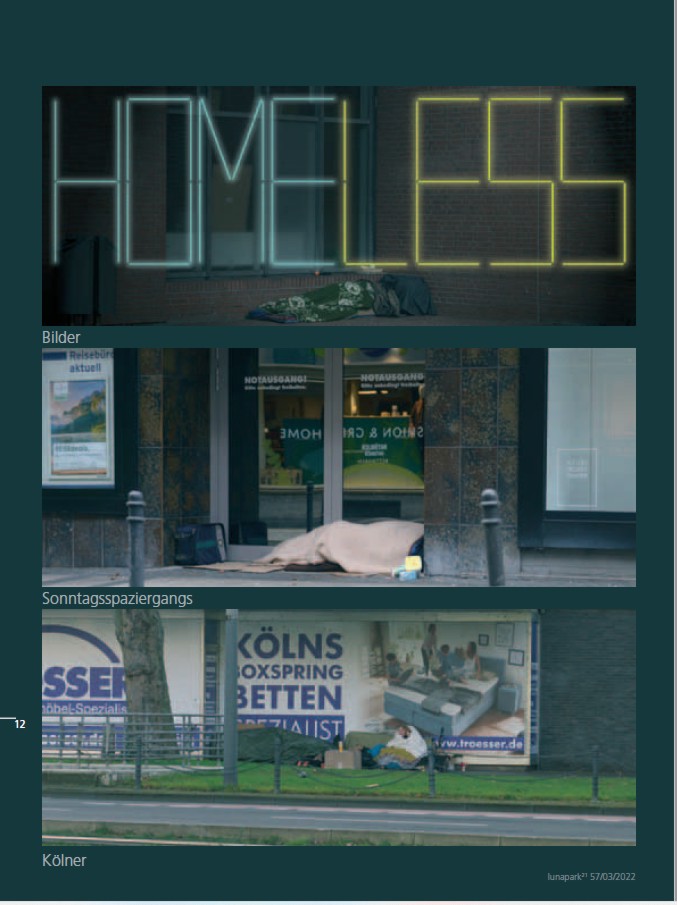Die Rentenreform in Frankreich
„Altersarmut“ ist zumindest bislang eher ein deutscher als ein französischer Begriff. Die Sprache ist auch hierbei Ausdruck der materiellen Verhältnisse. Denn die Statistiken belegen, dass jedenfalls in den letzten Jahren die absolute Armut im Rentenalter in der Bundesrepublik ein wesentlich verbreiteteres Phänomen war als in Frankreich.
Dies belegen auch Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). So zeigen Angaben aus der OECD Library von 2017 für das Jahr 2014 bezogen auf Deutschland einen Anteil der „Personen, deren Einkommen weniger als die Hälfte des verfügbaren Medianhaushaltseinkommens beträgt“, in Höhe von 9,5 Prozent bei den über 66-Jährigen, jedoch für Frankreich zum selben Zeitpunkt in Höhe von nur 3,6 Prozent.