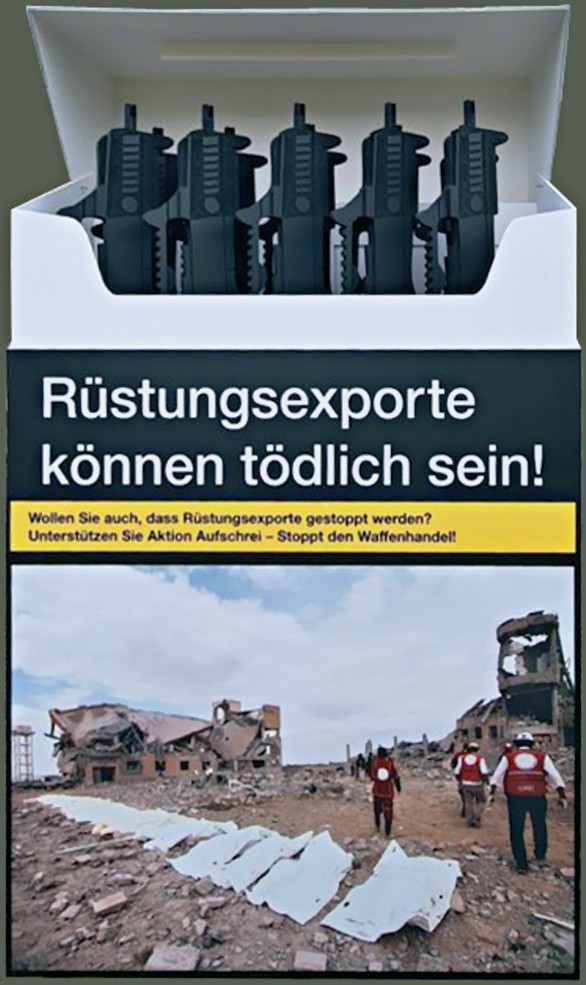Altersweise
Die Spezielle Relativitätstheorie publizierte Albert Einstein im Alter von 26 Jahren. Mit 36 schloss er die Allgemeine Relativitätstheorie ab. Die Zwanziger und Dreißiger waren seine produktivsten Jahre. Und das sind sie für die allermeisten Menschen. „Jetzt möchte ich gern in Ruhe vertrotteln“, gestand Einstein später.
Im Jahr 2010 lag die Fertilitätsrate in 98 Ländern unterhalb des zur Stabilisierung der Bevölkerungszahl nötigen Faktors von 2,1. Im Jahr 2021 blieben 124 Länder unter dieser Marge. Besonders niedrig ist die Fertilitätsrate in Italien und Japan, und in Südkorea liegt sie sogar nur bei 0,8. Selbst Indien kommt inzwischen auf knapp unter 2,1.