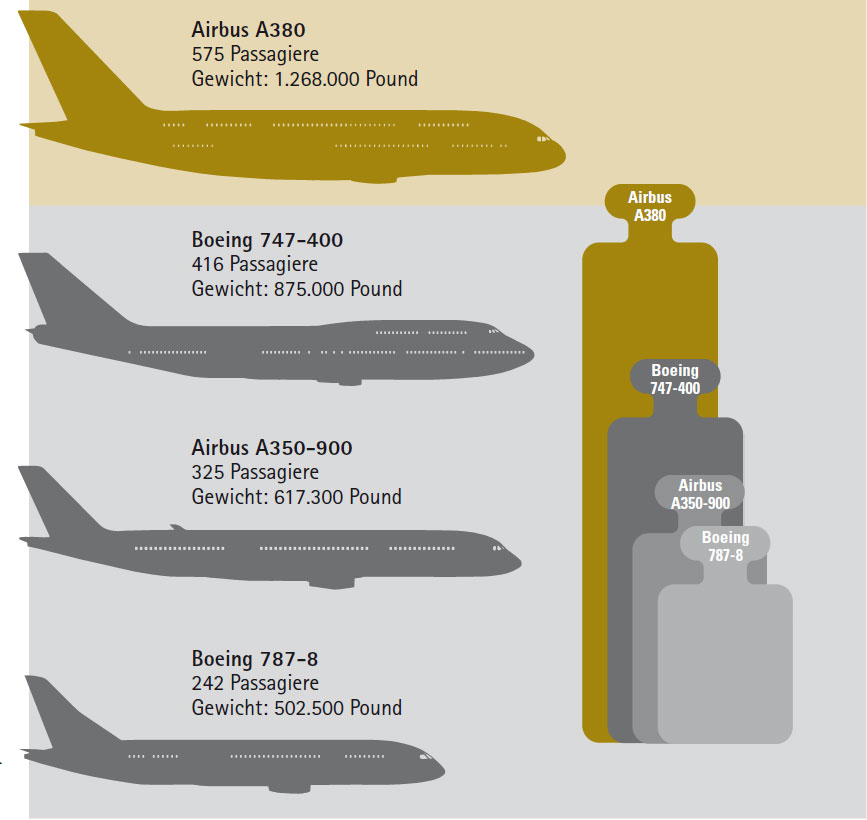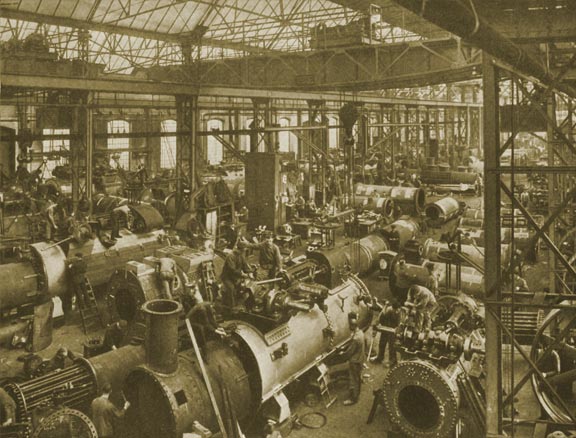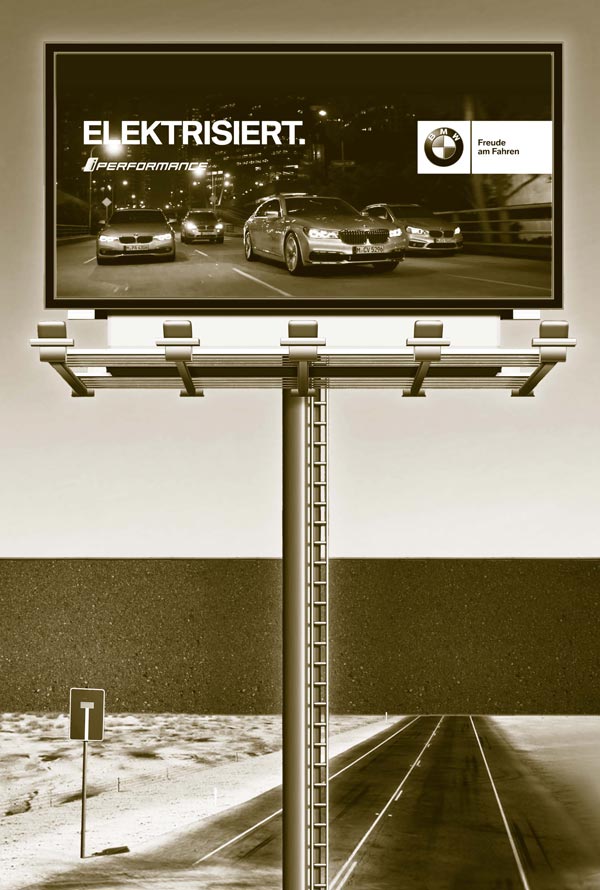Ein Diskussionsbeitrag auf der „Streikkonferenz“ in Braunschweig im Februar 2019
Drei
Vorbemerkungen seien gestattet.
Erstens:
1986 saß ich mit einem gewissen Prof. Ulrich Seiffert auf dem Podium
eines Kongresses zur Zukunft des Automobils. Damals sagte jener
Mensch, er war Entwicklungschef bei VW: „In fünf bis sechs Jahren
wird das Elektro-Hybrid-Fahrzeug auf dem Markt sein.“ Das war vor
gut drei Jahrzehnten![1]
Zweitens:
Ich werde am 24. März in Leipzig auf der dortigen Buchmesse mein
neues Buch vorstellen mit dem Titel: „Mit dem Elektroauto in die
Sackgasse. Wie Elektromobilität den Klimawandel beschleunigt“.
Drittens.
Ich bin mit allen hier im Saal solidarisch, wenn es um konkrete
Arbeitskämpfe geht. Das war so 1986, als ich in Puebla, Mexiko, vor
Ort den wochenlangen VW-Streik unterstützte und es dabei gelang,
dass im VW-Motorenwerk in Salzgitter ein Warnstreik in Solidarität
mit den VW-Beschäftigten in Puebla durchgeführt wurde. Die
Kolleginnen und Kollegen in Mexiko gewannen den Kampf. Das war so in
den 1990er Jahren, als ich zusammen mit Ford-Kollegen in Köln die
Zeitung „çözüm
yolu– linkseröm“
machte. Und das war so beim Opel-Streik 2004 in Bochum [2].
Doch diese praktische Solidarität entbindet uns nicht – als
vernunftbegabte und links engagierte Menschen – von einer
grundsätzlichen Kritik am Produkt Auto.
Übrigens:
Gestern Abend, bei der beeindruckenden Auftaktveranstaltung der
Streikkonferenz im überfüllten Saal, da wurden im Hauptreferat und
in allen Reden Dutzende spannende Streiks erwähnt und gewürdigt.
Doch der eine Streik, der am selben
Tag, an dem diese Veranstaltung durchgeführt wurde, stattfand,
dieser wurde von niemandem genannt – der Streik der Schülerinnen!
Nicht einmal die Vertreterin der GEW hatte den auf dem Schirm. Das
ist doch peinlich und absurd. Und vor allem ist das deshalb hier für
uns wichtig, weil diese jungen Leute eben nicht für mehr
Elektroautos auf die Straße gehen, sondern für eine Zukunft dieser
Generation auf dem Planeten. Und die wird es nur geben, wenn wir
unter anderem das Produkt Auto als solches kritisch betrachten –
wie in den folgenden sieben Thesen.
weiterlesenDas Elektroauto – eine Sackgasse