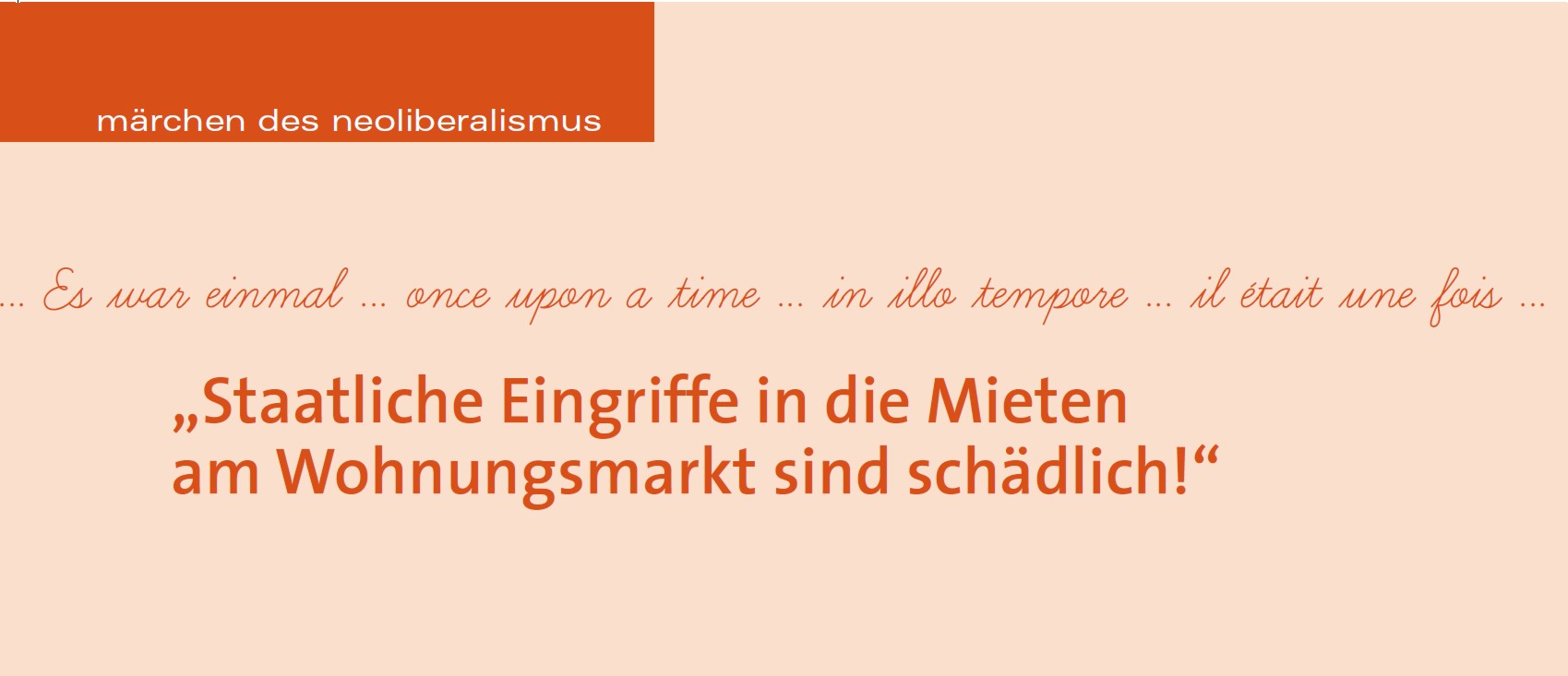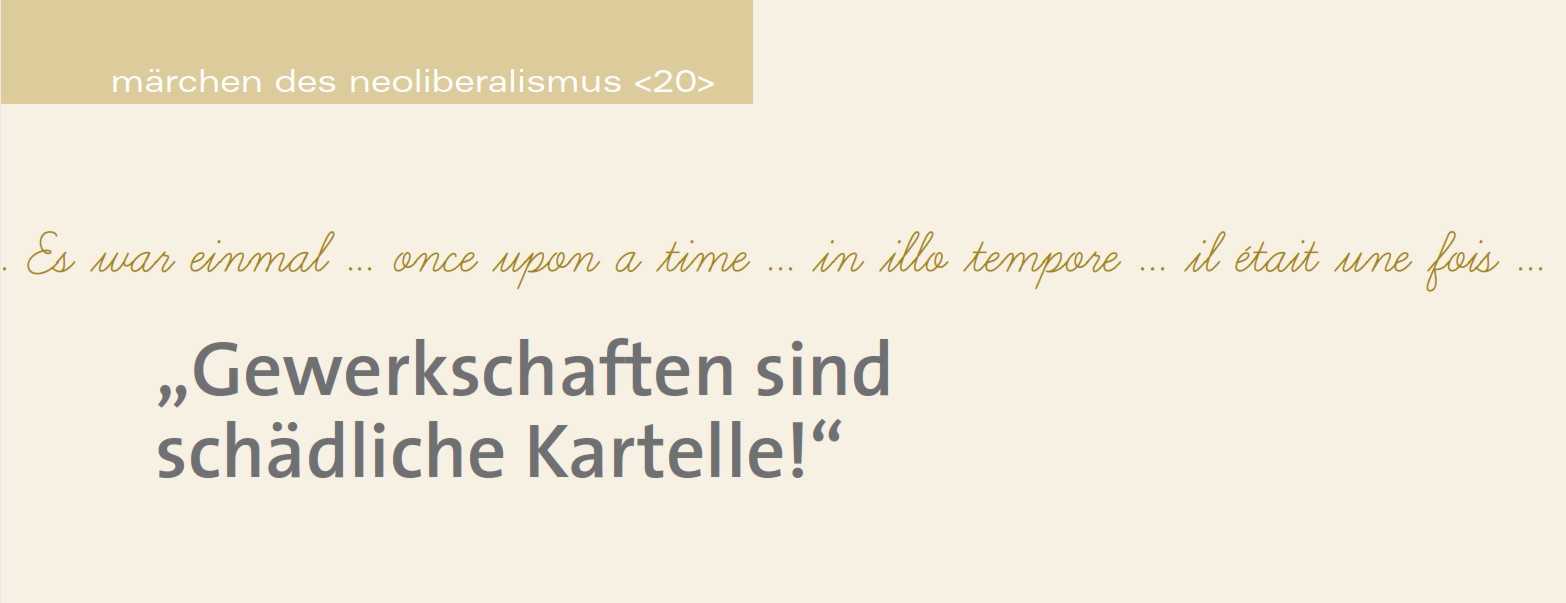Es war einmal eine Wirtschaftsjournalistin in Führungsposition mit klarem Gespür dafür, was sich für Wirtschaftsjournalismus im neoliberalen Kapitalismus gehört. Ihr Name war Ileana Grabitz, und von Marktpreisen war sie zutiefst überzeugt. Im August 2019 schrieb sie auf ZEIT Online in einem Kommentar zu Plänen des Berliner Senats, die Mieten am Wohnungsmarkt zu deckeln: „Doch statt kurzfristig am Mietpreis zu doktern, müsste die Politik vor allem am Angebot ansetzen: Wenn Vermieter die Miete in schwindelerregende Höhen treiben können, liegt das vor allem daran, dass die Nachfrage das Angebot weit übertrifft.“
weiterlesen„Staatliche Eingriffe in die Mieten am Wohnungsmarkt sind schädlich!“