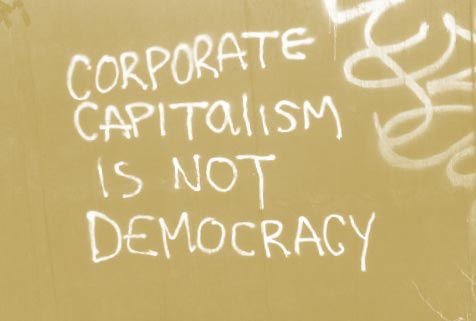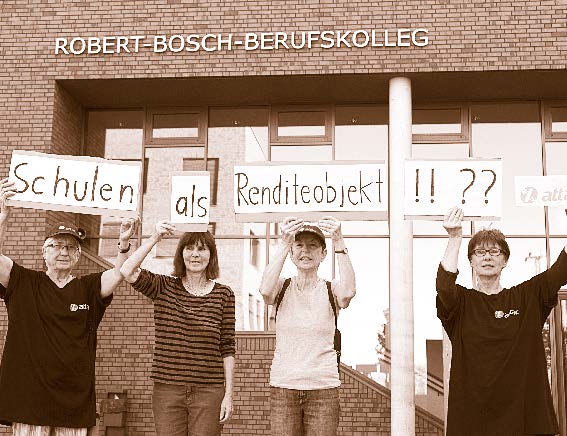ÖPP-Welle ergreift den globalen Süden
(Aus: LP21 Extra 2017/18)
Der Aufschrei war groß, als A1 mobil, die vor dem Bankrott stehende Betreiberfirma der Autobahn zwischen Hamburg und Bremen, die Bundesregierung auf 778 Millionen Euro zuzüglich 42 Millionen Verzugszinsen verklagte. Erneut scheiterte eine Öffentlich-Private Partnerschaft (ÖPP), erneut droht eine Plünderung öffentlicher Kassen zur Rettung exorbitanter privater Renditen. Was sich in Deutschland abspielt, ist jedoch keine Ausnahme, sondern die Regel. Ein Blick über den nationalen Tellerrand zeigt, dass ÖPPs grundsätzlich aus dem Ruder laufen.
Was Deutschland droht, lässt sich bereits jetzt in Argentinien studieren. Um höhere Mauteinnahmen durchzusetzen, verklagte der spanische Autobahnbetreiber Abertis – in die Bieterschlacht um dessen Übernahme stieg jüngst die deutsche Hochtief ein – die argentinische Regierung 2016 vor einem privaten Investitionstribunal in Washington. Abertis verlangte eine Entschädigung von umgerechnet 780 Millionen Euro, weil Argentinien sich einer geforderten Mautanpassung verweigerte. Die Klage zeigte Wirkung: Im Juni 2017 willigte Argentinien in einen Vergleich ein. Das Land stimmt nun einer Mauterhöhung zu, verzichtet auf seinen eigenen Mautanteil und verlängert Abertis‘ Konzession bis 2030. Obgleich es zu keinem Urteil kam, hat sich das Manöver für die Autobahnbetreiber gelohnt: Ihre Profite steigen und schreiben sich fort, zu Lasten der öffentlichen Hand.
weiterlesenGlobales Raubrittertum