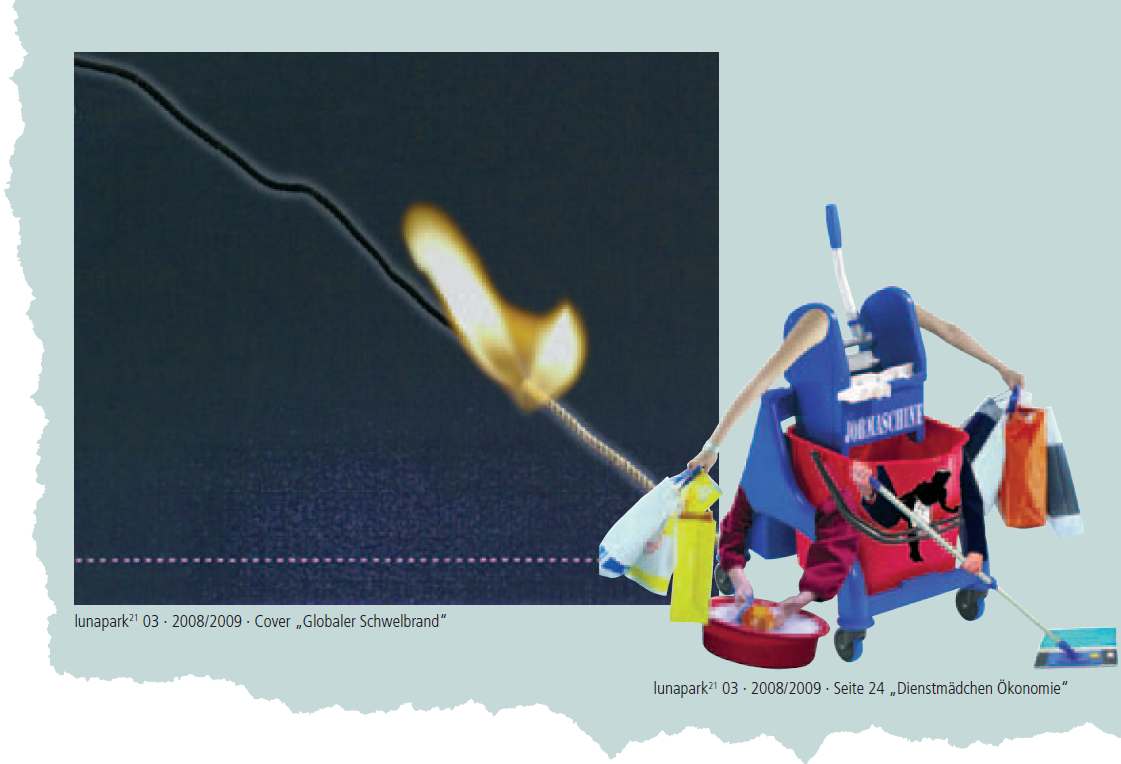Steigende Zinsen treiben erste Banken in die Krise
Mit erstaunlicher Verspätung produziert der internationale rasante Zinsanstieg die befürchtete Bankenkrise. Es tritt das ein, was die jahrelange Nullzinspolitik verhindern sollte.
Am 19. März übernahm die größte Schweizer Bank UBS die zweitgrößte Credit Suisse zu einem Spottpreis von drei Milliarden Schweizer Franken. Es handelt sich um einen Notverkauf, abzulesen daran, dass der Deal am heiligen Sonntag und nur dank einer Garantie von neun Milliarden Franken vom Staat und einer Liquiditätshilfe von 100 Milliarden Franken seitens der Schweizer Notenbank über die Bühne ging. Die Schweizer Großbanken sind nicht so solide, wie sie tun. Vor 15 Jahren während der großen Finanzkrise musste die UBS, damals der größte Vermögensverwalter der Welt (oder des weltweiten Kapitalismus), von der Notenbank vor dem Untergang gerettet werden.
Sie sind aber nicht weniger solide als anderswo, beispielsweise in den USA. In den USA kippten seit März drei mittelgroße Banken einfach um, als Kunden ihr Geld von den Banken plötzlich abzogen. Es war der klassische „Run“ auf die Bank. Heute findet auch der „Bank Run“ online statt und zwar, wie einige Bankmanager verblüfft feststellten, binnen Stunden und auch außerhalb der Geschäftszeiten.
Die Kunden, die der Silicon Valley Bank (SVB), der Signature Bank oder der First Republic davonliefen, waren auch nicht die klassischen kleinen Leute, sondern solche, die mehr als 250.000 Dollar auf dem Konto hatten. Auch der US-amerikanische Staat kennt eine Einlagensicherung, die FDIC (Federal Deposit Insurance Corp.). Sie garantiert die Einlagen der Kundschaft bei den etwa 4000 Kreditinstituten in den USA. Allerdings nur bis zur bescheidenen Höhe von 250.000 Dollar. Wer also eine oder fünf Millionen Dollar bei seiner Bank auf dem Konto hat, muss im Fall der Pleite dieses Instituts damit rechnen, dass er nur 0,25 Millionen zurückerhält. Das war für die junge, dynamische Kundschaft im Silicon Valley nach hartnäckigen Gerüchten, dass es der Hausbank SVB oder First Republic nicht so gut ginge, Grund zu einer größeren und hoffentlich stabileren Bank zu wechseln.
Millionärsrettung
Man braucht sich keine großen Sorgen um die zu langsamen, betroffenen Millionäre zu machen. Denn die brave Regierung in Washington dekretierte nach dem Ende der Bank zügig, dass auch Einlagen über die viertel Million hinaus erstattet werden. Das hätte allerdings einer Gesetzesänderung durch den Kongress bedurft. Aber so weit kam es gar nicht. Denn für die betroffenen Banken, die zunächst von der FDIC übernommen wurden, fanden sich Käufer, die auch die betuchte Kundschaft mitübernahmen und nun deren Konten führen.
Für die mittelgroße First Republic mit Sitz in San Francisco wurde zunächst unter Führung der größten Bank des Landes, J. P. Morgan, ein Stützungskredit von 30 Milliarden Dollar durch ein Bankenkonsortium zusammengestellt. Schon das erinnerte an die schönen Zeiten vor dem Ersten Weltkrieg, als im Jahr 1907 der Gründer und Namensgeber, der Bankier John Pierpont Morgan, die New Yorker Bankierskollegen in seinen Geschäftsräumen einschloss und solange Druck ausübte, bis sie der damaligen Bankenkrise durch den gemeinsamen Einschuss von frischem Geld ein Ende machten.
2023 reichte es nicht. Vielmehr übernahm die staatlich regulierte FDIC die First Republic Bank und schrieb sie öffentlich unter erheblichem Zeitdruck aus. J.P. Morgan bot den höchsten Betrag und erhielt den Zuschlag für 10,6 Milliarden Dollar. Das widerspricht zwar den Regeln, wonach die Marktführer vom Bietungsverfahren eigentlich ausgeschlossen sind. Aber der Hinweis, dass dadurch die Verluste für die bankenfinanzierte FDIC minimiert wurden, genügte, um die Kritik an der weiteren Monopolisierung des Bankenmarktes zu besänftigen. Der heutige Chef von J.P. Morgan, Jamie Dimon, kommentierte: „Das System ist sehr, sehr solide.“
Was aber hat die plötzliche Bankensterbewelle verursacht? Die Antwort der Aufsichtsbehörden lautet übereinstimmend, es seien die steigenden Zinsen, die den betroffenen Banken zum Verhängnis geworden seien. Wie aber das? Hieß es nicht während der langen Niedrig- oder sogar Nullzinsphase in klugen Kommentaren, niedrige Zinsen seien schlecht fürs Geschäft? Aber, so heißt es jetzt, Phasen schnell steigender Zinsen wie seit einem Jahr seien noch schwieriger.
Nullzins / Hochzins
Binnen eines Jahres, von März 2022 bis März 2023 ist der kurzfristige Zins (Tagesgeld oder „overnight money“) in den USA von null auf fünf Prozent gestiegen. Die Banken hätten langfristig Kredite zu niedrigen Zinsen ausgereicht, die weiterhin niedrige Zinseinnahmen erbrächten. Dem stünden aber hohe Ausgabenzinsen für die aktuell kurzfristig bei der Zentralbank besorgten Kredite gegenüber.
Die betroffenen Banken galten als grundsolide. Sie hatten in der Phase, als sie mit Kundengeld überschwemmt wurden, dieses nicht etwa in riskante und potenziell ertragreiche Papiere, sondern in Staatsanleihen und staatlich besicherte Hypothekenanleihen investiert, die über jeden Ausfall erhaben sind. Das Problem dabei: Der Wert solcher supersicheren Wertpapiere ist mit dem allgemein steigenden Zinsniveau deutlich unter den Nennwert gesunken. Beim Verkauf bringen sie weniger ein, als sie gekostet haben. Das heißt, die Banken würden Verluste erleiden, wenn sie die Papiere verkaufen, um sich Liquidität zu beschaffen. Wenn sie, wie üblich als Sicherheit dienen, um bei der Notenbank Kredit zu erhalten, sinkt auch der Betrag solcher Liquiditätshilfe, denn die Sicherheiten werden zu ihrem aktuell gesunkenen Wert hinterlegt.
Erstaunlich ist eigentlich, dass die steigenden Zinsen erst jetzt die ersten Opfer unter den Banken finden. Der Anlass für die Krise ist bei der Credit Suisse in der Schweiz und den drei mittleren Banken in den USA der Abzug von Einlagen ihrer betuchten Kundschaft, die zunächst nur verärgert war, dass ihre Einlagen niedriger verzinst wurden als bei der Konkurrenz. Dass diese Banken sogleich zu kippen drohten, hat, anders als in der Finanzkrise vor 15 Jahren, nichts mit einer in sich zusammenfallenden Spekulationsblase zu tun. Das Auf und Ab des Zinszyklus sollte eigentlich Alltag für die im Kapitalismus tätigen Banker sein. In solchen Kleinkrisen zeigt sich, dass Banken für ihre Aufgabe, das Geldvermögen von Kapitalisten und übrigen Bürgern zu halten, nicht ausreichend gewappnet sind. Da ist es ziemlich egal, ob die staatlich geforderte Eigenkapitalquote, vier, acht oder zwölf Prozent ausmacht.
Sonderbar ist auch, dass bisher keine Bank im Eurogebiet von der Fallsucht betroffen war. Als Erklärung bietet sich an, dass die Europäische Zentralbank die Geschäftsbanken in der Eurozone noch freundlicher behandelt als anderswo. Sie hat ihnen in der Nullzinsphase langfristige Kredite billig zur Verfügung gestellt und ihnen damit das Risiko sich verändernder Zinsen abgenommen. Sie hat zweitens die Zinsen später als die US-Notenbank und weniger hoch auf bisher nur vier Prozent gesetzt. Und sie hat drittens dafür gesorgt, das der Geldmarkt unter Banken immer noch in Liquidität schwimmt, so dass kurzfristiger Kredit unter Banken zu 3,5 Prozent zu erhalten ist.
Gefährlich für das jeweilige Finanzsystem sind Bank Runs, weil Banken untereinander in der Regel stark verschuldet sind. Wird eine Bank zahlungsunfähig, geraten die übrigen in unmittelbare Gefahr ebenfalls umzukippen. So weit ist es bei der Bankenkrise in diesem Frühjahr nicht annähernd gekommen.
Der Grund dafür ist die prompte Reaktion der staatlichen Behörden. Die gefährdeten Banken wurden rasch übernommen und schnell an die größeren Institute zu Vorzugskonditionen weitergereicht.
Kein Wunder, dass Jamie Dimon sagte, „the system is very, very sound“.
Lucas Zeise ist Wirtschafts- und Finanzjournalist. Er schreibt heute Bücher und in linken Publikationen Beiträge über das wirtschaftliche Geschehen im Weltkapitalismus.