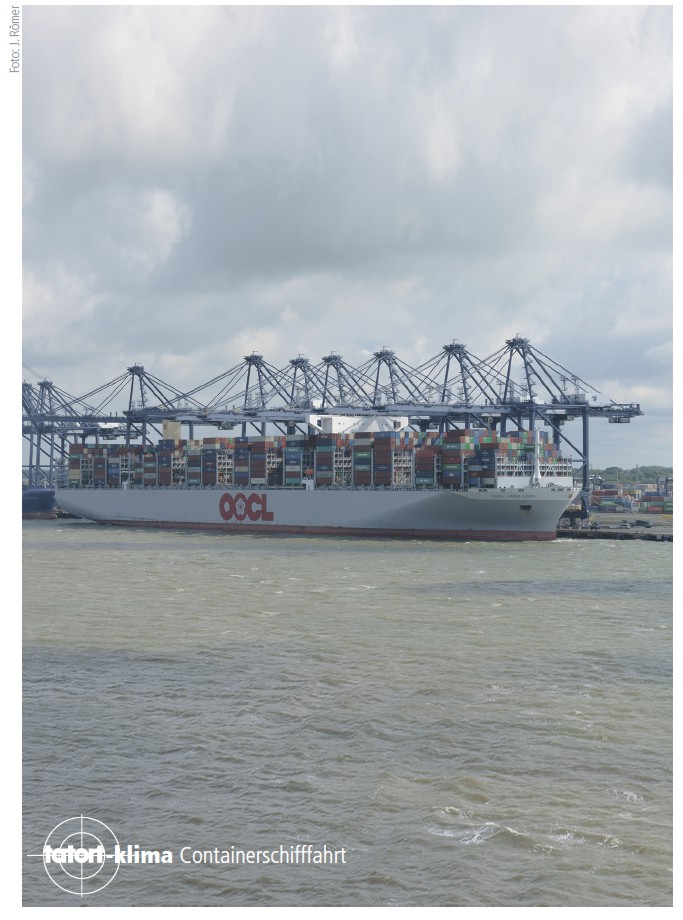Auch die 26. Klima-Konferenz blendete die Klima- und Umweltschädigungen der Seeschifffahrt aus.
Der Beitrag der Handelsschifffahrt zum Klimawandel war auf der Konferenz in Glasgow nur ein Randthema. Und das ist Schifffahrt schon seit bald 30 Jahren, als in Rio die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen beschlossen wurde.
In dem vor fünf Jahren beschlossenen Pariser Abkommen etwa ist nur von „national festgelegten Beiträgen“ der Vertragsparteien zu den vereinbarten Klima-Zielen die Rede. Die Seeschifffahrt (und der Luftverkehr) als meist grenzüberschreitende Formen von Mobilität sind daher nicht Gegenstand der Verhandlungen über klimaschützende Emissions-Reduktionen.
Das mag zwar für alle, die sich um den Klimawandel sorgen, völlig – Entschuldigung! – bescheuert klingen, entspricht aber globalen Standards. In der Sprache deutscher Klimakonferenzbürokratie klingt das so: „Der Schiffsverkehr ist in nationalen Seeverkehr und Binnenschifffahrt sowie internationale Seeschifffahrt zu unterscheiden. Die Emissionen aus dem internationalen Schiffsverkehr werden in den Emissionsinventaren nachrichtlich ausgewiesen, gehen aber nicht in die Gesamtemissionen ein.“ – So nachzulesen beim Umweltbundesamt1, entsprechende Formulierungen finden sich in nahezu allen Berichten und Studien, nicht nur national.
Zuständig für jedwede Vereinbarung zum internationalen Seeverkehr, also auch in Sachen Klimaschutz oder Emissionsminderung, ist die International Maritime Organization (IMO) mit Sitz in London. Aber diese Schifffahrtsorganisation der UNO weist Besonderheiten auf, die schon seit Jahren einem zügigen und effektiven Umweltschutz im Wege stehen.
Mitglieder der IMO sind zum einen 175 souveräne Staaten sowie drei „assoziierte“ Gebietskörperschaften, nämlich die Färöer, Hongkong und Macao. Zum anderen haben 63 zwischenstaatliche Organisationen Beobachterstatus sowie 80 internationale Nichtregierungsorganisationen beratenden Status. Laut Artikel 62 der IMO-Satzung hat jeder Mitgliedsstaat eine Stimme, Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst.
Torrey Canyon
Das klingt urdemokratisch – ist es in der Praxis aber nicht: Bereits 2018 hat die Organisation Transparency International (TI) mangelnde öffentliche Kontrolle und fehlende Beteiligung der Zivilgesellschaft bei der IMO kritisiert: Die Governance-Struktur der IMO begünstige einen unverhältnismäßig großen Einfluss der Privatwirtschaft sowie bestimmter Mitgliedsstaaten auf den politischen Gestaltungsprozess. TI stellte auch fest, die fehlende Rechenschaftspflicht der Delegierten behindere die öffentliche Kontrolle.2 Rueben Lifuka, seinerzeit stellvertretender TI-Vorsitzender, nahm Bezug auf aktuelle Klimaschutz-Debatten: „Für den gesamten Planeten steht zu viel auf dem Spiel, als dass die IMO weiterhin als geschlossener Laden operieren könnte.“
In den 1960er Jahren nahm die Menge des über See transportierten Rohöls ebenso zu wie die Größe der befördernden Tanker – kleine und große Unfälle sorgten für teils schwerste Schädigungen sensibler Meeresgebiete und Küsten. Am 18. März 1967 strandete vor der Küste Südenglands der unter Liberia-Billigflagge fahrende, 247 Meter lange Tanker „Torrey Canyon“, brach auseinander und sank acht Tage später. Rund 120.000 Tonnen Rohöl verschmutzten die Küsten Südenglands, der Normandie und der Bretagne. Neben vielen anderen Folgen hatte diese Katastrophe einen positiven Effekt: Die internationale Schifffahrt sah sich genötigt, ihre Angelegenheiten besser zu reglementieren – langsam zwar und oft lückenhaft, aber immerhin. Wobei die Langsamkeit bei der IMO prinzipieller Natur ist: 1948 war die Organisation, die bis 1982 Zwischenstaatliche Beratende Seeschifffahrts-Organisation (Inter-Governmental Maritime Consultative Organizat ion) hieß, entstanden – es brauchte aber zehn Jahre, bis die Gründungssatzung in Kraft treten konnte.
Solche Behäbigkeit wurde konsequent beibehalten. Als Reaktion auf den Fall „Torrey Canyon“ wurde mehr als sechs Jahre später, im November 1973, das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships; kurz MARPOL für „marine pollution“) vereinbart. Es enthält in 20 Artikeln allgemeine Verpflichtungen der Vertragsstaaten sowie Verfahrenshinweise und grundsätzliche Regelungen, die alle verbindlich sind. Technische Vorgaben sind in mehreren so genannten Anhängen geregelt: Sie betreffen Meeresverschmutzungen durch Öl (I), schädliche flüssige Stoffe (Chemikalien) als Massengut (II), Schadstoffe in verpackter Form, zum Beispiel Container (III), Schiffsabwässer (IV), Schiffsmüll (V) sowie Luftverschmutzung durch Schiffe (VI). Während die Anhänge I und II zum originären Abkommen zählen, lagen III-V zwar vor, mussten aber separ at ratifiziert werden; Anhang VI folgte später.
„Vereinbart“ heißt aber bei der IMO nicht auch „in Kraft“: Zunächst bedurfte es der Ratifizierung durch mindestens 15 Staaten, auf die mindestens 50 Prozent der Welthandels-tonnage entfielen. Das zog sich hin – bis 1979 lagen erst vier Ratifizierungen vor, auch die Bundesrepublik fehlte noch. 1978 wurde das Übereinkommen durch ein Zusatzprotokoll erweitert, Hauptgrund sollen Differenzen über den Chemikalien-Transport nach Anhang II gewesen sein.3 Zwar ermahnte dieses Protokoll die Vertragsstaaten auch, nun zügig zu ratifizieren, angepeilt wurde ein Inkrafttreten von MARPOL 73/78, wie es fortan hieß, im Sommer 1981. Tatsächlich erlangte das Übereinkommen samt der Anhänge I und II erst im Oktober 1983 Rechtskraft.
Zähflüssigkeit
In den Folgejahren und bis heute ist MARPOL 73/78 mehrfach überarbeitet und ergänzt worden – fast immer zäh. Das begann bei den Anhängen III-V: Als erste schaffte es Anlage V, 1988 in Kraft treten zu dürfen. 1992 – die Container-Schifffahrt war bereits mehr als 25 Jahre alt – erlangte Anlage III Rechtsgültigkeit – und bei Anlage IV dauerte es bis zum Jahre 2003.
Ratifizierungs-Vorgaben bewirken nicht nur zeitliche Verzögerung, sondern auch einen Primat der einflussreichsten Schifffahrtsnationen: Durch Koppelung der Mindestanzahl zustimmender Länder an einen bestimmten Prozentsatz der Welthandelstonnage geht in der IMO letztlich nichts ohne die vier größten Flaggenstaaten. Laut aktuellem Schifffahrts-Report der United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)4 kommen Panama (rund 16 Prozent), Liberia (rund 14), die Marshall-Inseln (rund 13) sowie Hongkong (knapp 10) bei der Tonnage auf eine Anteilsmehrheit von 52,6 Prozent – selbst wenn der Rest der Schifffahrtswelt sich zusammenschließen sollte, bräuchte es mindestens einen dieser Großen, um etwas durchzusetzen.
Der Haken an dieser Regelung: Die ersten drei dieser Länder sind so genannte Billigflaggenstaaten – sie werben dafür, dass Schiffe von Reedern und Eignern anderer Staaten (auch Deutschlands) zu ihnen „umgeflaggt“ werden, um Tarif-, Steuer- oder andere Normen des Heimatlandes zu umgehen. Das hat nicht nur Folgen für die Seeleute, Schiffe unter diesen Billigflaggen stellen oft auch ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar.5 Die Billigflaggenstaaten verdienen gut an der externalisierten Flaggenregistrierung, sind also bemüht, die fremden Reeder und Eigner nicht zu verprellen.
Daher neigen ihre Sachwalter bei der IMO dazu, bei verschärfenden Problemlösungen (die meist mit Kosten verbunden sind) das Inkrafttreten durch entsprechende Ratifizierungs-Schlüssel zu blockieren. Darüber hinaus sind IMO-Beschlüsse häufig gekennzeichnet durch überlange Fristen zur Umsetzung, Fortschritte in Kleinst-etappen, umständliche Überprüfungs-Vorschriften oder garantierte Unverbindlichkeiten. Das gilt übrigens nicht nur für Regelungen zum Meeresumweltschutz (Ballastwasserregelung, Verbot giftiger Schiffsrumpf-Anstriche etc.), sondern ebenso für technische oder soziale Vorschriften etwa zur Schiffssicherheit oder zur Ausbildung.
So auch beim Klimaschutz: Erst 1997 hatte die IMO überhaupt auf die bereits Jahre währende Debatte um den Klimawandel reagiert und MARPOL 73/78 um den erwähnten Anhang VI zur Luftverschmutzung durch Schifffahrt ergänzt – auf die verzögernde Art: Nach dem Beschluss 1997 dauerte es knapp acht Jahre, bis Anhang VI im Mai 2005 in Kraft trat. Aber das bedeutete noch keinen Durchbruch: Denn der zuständige Meeresumweltschutz-Ausschuss der IMO (Marine Environment Protection Committee; MEPC) beschloss im Juli 2005 erst einmal eine Überprüfung. Technische Verbesserungen, so hieß es, erforderten dies, um bessere Emissionsgrenzwerte zu erreichen. Die entsprechende Prüfung dauerte mehr als drei Jahre, so dass MEPC erst im Oktober 2008 einen überarbeiteten MARPOL-Anhang VI verabschieden konnte. Der trat dann im Juli 2010 in Kraft.
Er schrieb nun zwar der Schifffahrt vor, weltweit für schrittweise Reduzierung der Emissionen von Schwefeloxiden, Stickoxiden und Feinstaub zu sorgen, außerdem wurden bestimmte Seegebiete – beispielsweise Nord- und Ostsee – zu so genannten Emissionskontrollgebieten erklärt, dort gelten schärfere Grenzwerte für bestimmte Luftschadstoffe als auf den übrigen Meeren. Aber immer sind diese Regelungen mit Abstufungen – zeitlich, regional, nach Schiffsgrößen oder -baujahren – oder anderen Verzögerungs-Optionen versehen.
Schweröl
Der Umgang mit dem bis heute am weitest verbreiteten Schiffstreibstoff, dem so genannten Schweröl, mag hier als Beispiel dienen: Die zähflüssige, schwarze und stinkende Masse ist, grob gesagt, Restabfall aus der Raffinierung von Rohöl und enthält eine ganze Palette gefährlicher Schadstoffe. Vor Verwendung als Treibstoff muss sie an Bord erst erhitzt werden, verbrennt dann aber bei weitem nicht vollständig, sondern schickt diverse Schadstoffanteile durch den Schornstein. Gesundheitliche und ökologische Folgen dieser „Abfallbeseitigung auf See“ sind seit langem bekannt, trotzdem ist das vergleichsweise billige Zeug bis heute nicht verboten.
Unter anderem enthält Schweröl erhebliche Schwefelanteile. Als MARPOL-Anhang VI in Kraft trat, wurde zunächst eine Reduzierung des Schwefelgehalts im Treibstoff auf 4,5 Prozent vorgeschrieben (im globalen Schiffsverkehr, außerhalb der Emissionskontrollgebiete), Anfang 2012 trat eine weitere Senkung auf 3,5 Prozent in Kraft. Erst 2016 wurde festgesetzt, den Schwefelgrenzwert auf 0,5 Prozent abzusenken – aber erst ab 1. Januar 2020 und vorbehaltlich einer knapp zweijährigen „Machbarkeitsprüfung“. Deren Ergebnis, abgesegnet von MEPC im April 2018, bedeutete eine Verhöhnung aller, die sich um Schiffsemissionen und Klimaschutz Sorgen machten, denn natürlich gab und gibt es einerseits längst Alternativen im fossilen Bereich, von entschwefelten Dieselarten oder Destillaten bis zum Flüssiggas, andererseits zeichneten sich Ansätze ab, nichtfossile Antriebsarten zu erforschen und auszuprobieren.
Eigentlich hätte die Ära Schweröl längst vorbei sein müssen – aber die IMO sorgte dafür, dass das Zeug zugelassen bleibt: Sie knüpfte die weitere Verwendung an die Bedingung, dass an Bord so genannte Scrubber installiert sind, die eine Rauchgaswäsche vornehmen. Dabei wird das Abgas so weit gereinigt, dass alle Grenzwerte eingehalten werden – das dreckige Waschwasser dieses Prozesses indes wird häufig ins Meer abgeleitet.6 Die Frage „Schweröl oder nicht?“ wird so zu einer bloßen Kostenkalkulation, mehrere Tausend Schiffe wurden bis heute mit Scrubbern ausgestattet, darunter viele Tanker und Containerschiffe.
Der Beschluss, den MEPC im April 2018 – nach besagter Machbarkeitsprüfung – als „Verabschiedung einer IMO-Klimaschutzstrategie“ feierte, ist skandalös: Die pazifischen Inselstaaten hatten eine Regelung verlangt, die Schifffahrt bis 2050 quasi klimaneutral zu machen („hundertprozentige Emissionsminderung“); stattdessen reichte es zweieinhalb Jahre nach dem Pariser Abkommen nur zu einem „50 Prozent bis 2050“ – unverbindlich. Wobei als Bemessungsgrundlage für diese Emissionssenkung die Werte von 2008 festgelegt wurden – eine weitere Frechheit, denn zum Zeitpunkt des Beschlusses war laut dem International Council on Clean Transportation der Treibstoffverbrauch der globalen Schifffahrt bereits um mehr als 17 Prozent und der korrelierende CO2-Ausstoß um mehr als 18 Prozent gegenüber 2008 zurückgegangen – eine kombinierte Folge von technischer Entwicklung, Weltwirtschaftskrise und punktuell beginnender Deglobalisierung.
Gute Laune
So kann etwa anlässlich des Glasgow-Gipfels einer der größten nationalen Eigner und Manager von Containerschiffen, Peter Döhle, jubeln, die von der IMO gesetzten Klimaziele rückten „bereits in Reichweite“, die Branche habe bereits heute ihren CO2-Ausstoß in Bezug auf 2008 um fast 48 Prozent vermindert.7
Spät, aber immerhin hat die IMO auch versucht, Einfluss auf die Schiffstechnik zu nehmen. 2011 beschloss MEPC mit dem Energy Efficiency Design Index (EEDI) einen Minimalkonsens für Schiffsneubauten auf niedrigem Niveau: Zur Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen sind seit 2015 Energiespar-Vorgaben für Schiffsneubauten obligatorisch – allerdings geht es bis 2019 nur um eine Effizienzverbesserung um zehn Prozent, zur Zeit läuft EEDI-Phase 2 mit einer Vorgabe von 20 Prozent. Inzwischen ist das Paket um den Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) für eine Effizienz-Anpassung der bestehenden Flotte erweitert worden, der wird aber erst ab 2023 und dann auch wieder nur schrittweise wirksam.
Abschließend: Die IMO steht unter Druck, bleibt bislang aber behäbig. Es gibt Forderungen, die Klimaschutzambitionen der Schifffahrt auf ein Netto-Null-Ziel bis 2050 festzulegen. Es gibt Ideen und Vorschläge, alternative Antriebsarten (Wasserstoff, Ammoniak, Wind-Revival etc.) auszuprobieren oder auch zu kombinieren.
In Glasgow ist jüngst auch ein Vorschlag der britischen Regierung für eine globale Initiative namens Clydebank Declaration erörtert worden: Partnerschaften von zwei oder mehr Unterzeichnern sollten sich verpflichten, die Einrichtung „grüner Schifffahrtskorridore“ (im Sinne emissionsarmer oder -freier Schifffahrtsrouten zwischen jeweils zwei Häfen) zu unterstützen. Das Echo war mäßig: 22 Staaten haben die Deklaration bislang gezeichnet8 – sie stehen für nicht einmal ein Viertel der Welthandels-tonnage, deutlich zu wenig für eine IMO-Durchsetzung. Zeitgleich kritisierte in Bremen der Chef des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, Burkhard Lemper, unter Bezug auf die massiven Neubestellungen, die aktuell die Orderbücher der großen Werften füllen, diese Entwicklung sei nicht geeignet, die gesetzten Klimaschutzziele zu erreichen. Bestellt sei überwiegend Tonnage mit konventionellen Motoren beziehungsweise mit Scrubbern. Lem per: Was in den nächsten drei Jahren gebaut werde, fahre in 30 Jahren immer noch.9
Ob das eine oder andere Ziel wirklich realisierbar ist, sich durchsetzt oder dann auch Erfolge zeitigt, ist derzeit nicht abzuschätzen. Sicher ist: „Netto-Null-“ oder Alternativantriebs-Ideen werden von Schifffahrtsseite bislang sofort mit Subventionswünschen beantwortet. Die Schifffahrt ist – aber das wäre eine andere Geschichte – eine Branche, die (zumindest hierzulande) hochsubventioniert ist und dennoch für jeden Wandel und jede Innovation weitere Förderung und Vergünstigungen fordert. Ein Umdenken der Branche hin zum gesellschaftlich verantwortungsvollen Handeln steht aus.
Burkhard Ilschner ist verantwortlicher Redakteur des Projekts WATERKANT. 1986 als maritime Zeitschrift gegründet, musste deren Print-Erscheinen Ende 2019 eingestellt werden; seither entwickelt sich daraus ein kostenloses digitales Informationsprojekt zur Meerespolitik: siehe https://waterkant.info – Beteiligung ist erwünscht.
Anmerkungen und Quellen:
1. https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/berichterstattung-unter-der-klimarahmenkonvention-6.
2. https://www.transparency.org/en/press/obstacles-to-reform-at-un-shipping-agency-threaten-climate-goals
3. Bundestags-Drucksache 9/692
4. https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2021_en_0.pdf
5. https://www.itfglobal.org/de/sector/seafarers/billigflaggen
6. WATERKANT, Jg. 34, Heft 136, Dezember 2019, S. 7 ff.
7. Deutsche Verkehrs-Zeitung (DVZ) vom 11. November 2021
8. https://www.gov.uk/government/publications/cop-26-clydebank-declaration-for-green-shipping-corridors
9. Weser-Kurier vom 10. November 2021